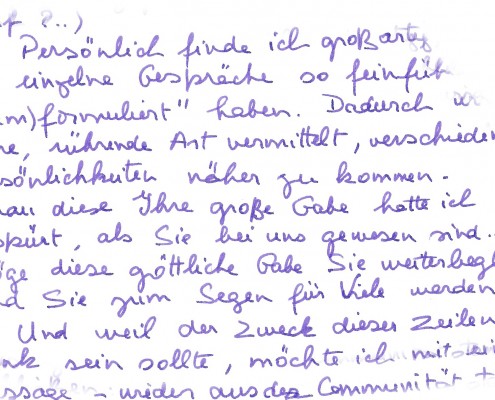Das Jahr 2013 markiert in vielerlei Hinsicht für mich einen Neuanfang. Nach einem gesundheitlichen Tiefschlag im Frühjahr hatte ich das Glück, nach langer Krankheit zum Sommerende wie ein Phoenix aus der Asche emporzusteigen – zum großen Finale gewissermaßen, so sehe ich das jedenfalls mit 58 Lebensjahren. Ich habe viel gelernt, vor allem über mich, ich konnte mit einer Reihe sehr schmerzvoller Erfahrungen aus der Vergangenheit abschließen und ich hatte eine ganze Reihe von wundervollen Begegnungen mit Menschen, von denen ich mittlerweile behaupten darf, dass sie mir nahestehen.
„Du hast dich verändert!“ Besser als alle Selbsteinschätzungen beschreiben mir Menschen, die mich lange nicht gesehen haben, dass sich etwas verändert hat. Kann ich das bestätigen? Von Bonn aus bin ich noch einmal in die Berge gefahren, um mich einige Tage auf über 2000 Metern herumzutreiben. Mein primäres Ziel: Herausfinden, wie ich mich verhalten werde, „when the going gets rough“. Kommt die alte Angst wieder, der Kleinmut, die Verzagtheit? Also nichts wie rein in lauter neue Gewohnheiten. Erstmals fahre ich mit einer Mitfahrgelegenheit – das ist ungewohnt. Klar komme ich mir alt vor. Aber laute Musik und das Hinten-sitzen sind eine tolle Erklärung für Schweigsamkeit. Nachdem der junge Mann, der bis dahin das Gespräch bestimmt hat, in Stuttgart ausgestiegen ist, komme ich jedoch mit Sonja, der Fahrerin, und Johanna, einer weiteren Mitfahrerin, ins Gespräch. Wir sprechen über ihre Studien- und Zukunftspläne und ich empfinde endlich einmal keine Wehmut darüber, dass ihre Zukunft schon lange hinter mir liegt. Denn schließlich liegt meine noch vor mir und sie wird ganz großartig sein.
Heute ist jedoch noch nicht einmal die Gegenwart zu sehen. Fast zwei Monate war ich in diesem Sommer im Allgäu und das Wetter war ein Traum. Doch kaum passt man mal kurz nicht auf und fährt für zwei Wochen nach Norddeutschland, schon schlägt das Wetter um. Als wir in Kempten, von wo aus Johanna weiter nach Oberstdorf fahren will, ankommen, scheint die Welt unterzugehen. Es schüttet wie aus Eimern, von meinen geliebten Bergen ist nichts zu sehen, und wenn mal einer rausguckt aus den tiefhängenden Wolken, dann trägt er ein weißes Häubchen. Ideales Wanderwetter sieht anders aus.
Sonja setzt mich in Reutte, dem ersten österreichischen Ort hinter der Grenze gleich südlich von Füssen, ab, oder besser: aus. Aber ich habe Glück im erstbesten Gasthof und bekomme ein Zimmer. Gemütlich ist es nicht, aber es regnet nicht hinein, und nach einiger Zeit habe ich auch raus, wie ich die üppige Neonbeleuchtung vermeiden kann. Trotzdem, das ist ein Tiefpunkt. Ich bin allein, ich fühle mich einsam, es ist kalt und grau und nass. Schocktherapie ist angesagt, also laufe ich ein wenig durch den klammen Ort. Schon besser! Früher habe ich mich in ungemütlichen Hotelzimmern immer mit dem Fernseher vergnügt, aber es ist schon erstaunlich, wie schnell man sich das Fernsehen abgewöhnen kann. So bleibt mir nichts anderes übrig, als sehr früh ins Bett zu gehen. Der nächste Morgen: Siehe da, die Nacht war erholsam. Wie immer nutze ich den Frühstücksraum, um meine Mitreisenden zu studieren. Komisch, wie es sich manche Männer bieten lassen, das ihnen ihre Frau das Essen zusammensucht. Oder wollen die das so? Ich versuche, in Kamel-Manier so viel wie möglich in mich hineinzustopfen, mein Budget für diese Reise ist begrenzt. Doch wenn man 10 Kilo abgenommen hat, leidet auch die Aufnahmekapazität. Da bleibt mir schließlich nichts anderes übrig, als mir das, was ich nicht mehr essen kann, in die Taschen zu stopfen.
Zum Glück komme ich schnell an einen Regenüberzug für meinen Rucksack, der sich auch unmittelbar bewähren muss, denn der Regen lässt einfach nicht locker. Warum das Wetter jetzt so schlecht sein muss, frage ich mich wiederholt. Was ich mich aber nicht mehr frage, und das herauszufinden war ja das Ziel dieser Reise: Bin ich hier richtig? Sollte ich vielleicht wieder abreisen, oder sollte ich woanders hinfahren, oder oder oder? Und nun sitze ich also im Bus und fahre ins Lechtal, das Alpental mit einem der letzten ungezähmten Alpenflüsse, der sich mehr oder weniger ungehindert sein Bett im weiten Bett sucht. Eine geradezu seelige Entspannung darüber, dass ich jetzt „mein Ding“ mache, der nachlassende Regen und sogar der eine oder andere verirrte Sonnenstrahl auf den überzuckerten Lechtaler Bergen: Mir geht es richtig gut. Der erst vor zwei Jahren eingeweihte Lech-Wanderweg folgt dem Fluss von seiner Quelle beim gleichnamigen Skiort bis nach Füssen, eine Strecke, die sich je nach Kondition in fünf bis 10 Tagen gut bewerkstelligen lässt. So viel Zeit habe ich leider nicht, also steige ich in Farchau aus und wandere ins Tal hinein. Der Lech macht wirklich etwas von sich her, die tagelangen Regenfälle hatten den Umfang gewaltig anschwellen lassen. Mal gurgelt es direkt neben mir, mal ist’s ganz ruhig, weil sich die Hauptlast des Wassers einen anderen Weg weit entfernt gesucht hat, mal fehlt aber auch ein Stück des Weges, weil der Fluss nun gerade hier lang fließen wollte. [photoshelter-img i_id=“I00000D7lEbzjjRo“ buy=“0″ width=“600″ height=“418″]
Ich bin jetzt richtig gut drauf, egal ob es nun regnet oder nicht, ich singe beim Wandern (hört ja keiner bei dem Wetter) – aus dem Alleinsein vom Abend zuvor ist wieder mal ein All-eins-sein geworden und wenn sich doch mal wieder einige Regentropfen nach unten verirren, lächele ich sie einfach weg. Als ich allerdings in Vorderhornbach feststelle, dass der Bus entweder schon weg oder gar nicht gekommen ist, friert mir das Lächeln doch etwas ein. Eigentlich hatte es heute bis hier genügen sollen. Im Wirtshaus mache ich einen Crashkurs in Entschleunigung – zwei alte Dorfbewohner können sich partout nicht einigen, ob der Bus nun normalerweise pünktlich kommt oder gar nicht. Egal. Da hilft nur noch ein langgezogenes „Ommmmmhhhh! Und kurze Zeit später kommt mein Lächeln zurück, als die Bedienung mich mit einem Kaffee und einem warmen Apfelstrudel – „Vorsicht, sehr heiß, frisch aus dem Rohr!“ und einer Extraportion Schlagsahne verwöhnt.

Schon ist mir, als hätte ich noch unendlich Kraft und ich folge den Schildern des Lechwegs, deren Planer dem Wanderer etwas Gutes tun wollten. Erst geht“s steil bergauf und dann auf einem Panoramaweg hinan, der aber einige Auf und Abs eingebaut hat. Bei Sonne und ausreichenden Kraftreserven sicherlich kein Problem. Aber als ich dann nach ungefähr sechs Stunden Fußmarsch im Dörfchen Elmen ankomme, wanke ich in den erstbesten Gasthof und nehme mir ein Zimmer. Um ein Haar vergesse ich vor dem Duschen das Ausziehen. Später, beim Essen im Gastraum, setzt sich der knapp 80jährige Wirt zu mir, der für jeden Gast ein freundliches Wort hat und von seiner Tochter umsorgt wird. Wir kommen ins Gespräch und er erzählt voller Trauer, dass seine Frau im Frühjahr gestorben ist. Ein kurzer Moment der Verbundenheit, ich kann mit ihm fühlen. Anfangs bemüht er sich noch sehr um Hochdeutsch, doch je länger wir reden, desto schwerer fällt es mir, ihn zu verstehen. Er fühlt sich offenbar wohl in meiner Gesellschaft.
Tag Zwei
Eigentlich wollte ich gestern noch bis Häselgehr kommen und die Falchs besuchen. Schade, dann wird das eben diesmal nichts, hatte ich mir am Abend eingeredet. Doch heute Morgen sitze ich im Bus und weiß: Diesen Besuch wirst du nicht ausfallen lassen. Meine Frau und ich waren vor zwei Jahren im Winterurlaub auf dem Bio-Bauernhof der beiden. Schon der Empfang war überwältigend: Als wir nach langer Fahrt ankamen, war der Tisch in der Ferienwohnung zum Abendbrot gedeckt. „Das machen wir für alle Gäste so“, erklärte Hildegard Falch. Wir haben sie und ihren Mann Otto im Laufe des Aufenthalts wirklich ins Herz geschlossen. Nun also komme ich nach einem ergiebigen Regenschauer dort an – allein – und fühle, als würde ich …. davon später mehr. Im Hausflur rufe ich, ob jemand da sei, und schließlich kommt Hildegard, wie ich sie jetzt nennen darf, um die Ecke. Sie erkennt mich sofort, wenn sie auch meinen Namen nicht mehr weiß und bittet mich in die Küche.

Hildegard mit dem Riesenschnauzer, dessen Name ich mir nicht merken kann.
Kurze Zeit später steht heißer Tee auf dem Tisch, einige Scheiben Brot und Almkäse, der den ganzen Raum mit seinem Duft erfüllt. Für Aufregung sorgt der Nachfolger des Riesenschnauzers, den wir bei unserem Besuch kennengelernt hatten und der schon damals sehr krank war. Leider musste er eingeschläfert werden. Dieser junge Hund hat einen sehr vornehmen Namen, leider halten seine Manieren noch nicht Schritt. Vor lauter Begeisterung reißt er alles um, aber – man kann ihm natürlich nicht böse sein. Erst, als Frauchen ihn mit Butterbrot füttert, gibt er etwas Ruhe. Dieser alten Frau, die ich sehr mag, erzähle ich mein Jahr, mit allen Höhen und Tiefen. Ich lasse nichts aus und sie hört mir geduldig zu. Irgendwann sage ich, dass ich mich wie neugeboren fühlen würde und sie sieht mich freudestrahlend an und sagt, dann hätte ich den nächsten Urlaub ja bei Ihnen frei! Schließlich würden alle Neugeborenen etwas geschenkt bekommen.
Dies sind für mich wahrlich nährende Stunden und irgendwann sage ich zu Hildegard: „So, ich muss jetzt weiter, damit ich heute noch irgendwo ankomme“. Mein Plan ist ja noch das Erreichen der Rappenseehütte. Hildegard sieht mich ganz ruhig an und sagt zu mir: „Ich habe das Gefühl, du bist schon angekommen!“
Im Gegensatz zu früher bin ich trotzdem gegangen. Nach einer sehr langen und innigen Umarmung habe ich die Wohlfühloase verlassen und habe den Weg weiter verfolgt, den ich eingeschlagen hatte. Ich weiß, dass Hildegard es Ernst meinte, als sie sagte, ihre Tür würde mir immer offen stehen.
[photoshelter-img i_id=“I0000n8zooRcgW04″ buy=“0″ width=“300″ height=“460″ align=“left“]
Von Steeg aus steige ich schließlich ins einsame Hochalptal hinauf. Vielleicht liegt es an der späten Jahreszeit, vielleicht wird der Weg aber auch nicht oft begangen: die nächsten sechs Stunden bin ich allein und es ist großartig. Unten Lärchen bestanden, weitet sich das Tal oben und vor der letzten Steilstufe kommt ein schlammig-brauner Wasserfall herunter. Ich mache eine Pause und bewundere den Mut von Enzian und Eisenhut, die in den ersten Schneeflecken gegen den Herbst anblühen.
[photoshelter-img i_id=“I0000abO5CY0dWjg“ buy=“0″ width=“600″ height=“418″] Die Schneehöhe steigt kontinuierlich, aber die Markierungen sind noch gut zu sehen. Eine Gemse kreuzt meinen Weg, völlig ohne Arg steht sie schließlich nur noch 30 Meter von mir entfernt. Wir betrachten uns ruhig, vielleicht, weil wir beide wissen, dass wir keine Angst voreinander haben müssen. Ich wühle mich weiter durch den Schnee nach oben und komme schließlich mit einem Seufzer der Erleichterung auf dem Heilbronner Weg an.
Wie so oft in den Bergen werde ich belohnt, als ich nicht damit rechne. Kurz vor Erreichen der Rappenseehütte zaubert ein Sonnenuntergang wundervolle Motive und knipst ein geradezu überirdisches Licht an. Gut, dass ich Fotograf bin, denn hier fehlen mir fast die Worte.
[photoshelter-img i_id=“I0000V3E07edaI90″ buy=“0″ width=“600″ height=“418″]
Die Hütte ist eine Enttäuschung. Ich war schon auf vielen und weiß: je leichter sie zu erreichen sind, desto mehr sind sie zu Rummelplätzen von lärmenden Wandergruppen verkommen, die am Abend im Gastraum darum wetteifern, wer am lautesten herumbrüllen kann. Nach der Einsamkeit beim Aufstieg eine schmerzliche Erfahrung.
strong><h3>Dritter Tag<</h3></strong>
Beim Frühstück herrscht Ruhe – kein Wunder, denn wer sowieso ins Tal absteigt, hat es nicht eilig mit dem Aufstehen. Ich bin unsicher, ob ich auch absteigen soll – irgendwie lockt Oberstdorf schon – oder noch den Weg zum Waltenberger Haus in Angriff nehme. Das Wetter wird halten, da bin ich sicher, aber dass der Heilbronner Weg offenbar so wenig begangen wurde in diesen Tagen, irritiert mich schon. Ich frage die Hüttenmannschaft nach der Gehzeit und werde ziemlich rüde abgefertigt. Normal 4 bis 5 Stunden, heute 8 bis 9, lautet die Antwort. Aus Erfahrung weiß ich, dass die Hüttenmannschaften unsicheren Kantonisten gern ein wenig Angst machen. Schließlich haben sie keine Lust, irgendwelche Flachlandtiroler Stunden später aus misslichen Lagen zu befreien. Ich finde aber, dass ich nicht so unerfahren wirke. Als ich mich dennoch entscheide, im Hüttenbuch meinen Abstieg einzutragen, stelle ich fest, dass direkt vor mir einige andere Bergsteiger auf die von mir ursprünglich geplante Route gestartet sind. Was die können, …. Also nichts wie hinterher.
Die ersten 20 Minuten, das kenne ich schon, läuft’s noch etwas unrund. Aber schon bald bin ich gut unterwegs und gehe ein Stück des Weges vom gestrigen Abend zurück, bis ich schließlich Neuland betrete. Ich komme gut voran, nehme mir aber vor, mir Etappen vorzunehmen, so dass ich über Weitergehen oder Umkehren entscheiden kann. Doch bevor das nächste Zeitlimit erreicht ist, wird der Weg spürbar schwerer, die ersten Drahtseiletappen beginnen. Da muss ich dann wohl weitergehen. Doch zuvor gönne ich mir noch einen Blick zurück. Vor mir liegt ein weites Hochkar, schon ganz in der Ferne der Einschnitt, durch den ich vor zwei Stunden gekommen bin. Weit hinten schaut der Gipfel des Ifen vorwitzig aus den Wolken.
[photoshelter-img i_id=“I0000pOi6_DgbKoU“ buy=“0″ width=“600″ height=“418″ align=“left“]
Das ist es, was ich an den Bergen so liebe. Die Weite, die Ruhe, die Einsamkeit, aber auch die Strenge, wenn wie jetzt, die Bedingungen schwierig sind. An Stellen, wo der Schnee sich gehäuft hat, versinke ich auch schon mal bis zu den Knien. Dies ist nicht der Mont Blanc und dennoch muss man wissen, was man tut, insbesondere dann, wenn man wie ich allein ist. Darum wird das Gehen jetzt so langsam auch mehr zum Tasten. Ein Fehltritt hätte böse Folgen. Rechts die drahtseilbewehrte Felswand, links der Abgrund und in der Mitte der Weg, der jetzt unter fast einem halben Meter Schnee verschwunden ist. Die Trittspuren meiner Vorgänger sind mal mehr und mal weniger gut geeignet und einmal rutsche ich weg und lasse ein kleines Schneebrett in die Tiefe rauschen. Schreck, lass nach!
[photoshelter-img i_id=“I0000r39j.nLfm.g“ buy=“0″ width=“266″ height=“202″align=“left“] [photoshelter-img i_id=“I0000XVbwn.RLCr4″ buy=“0″ width=“266″ height=“202″align=“right“]
Jetzt zeigt sich, dass überlegtes Rucksackpacken eben doch seine Vorteile hat. Ich verfluche jedes Gramm, dass ich zuviel dabei habe und es sind so einige. Irgendwie geht’s aber dennoch weiter und nach der Karte müsste ich eigentlich schon recht weit sein. Da sehe ich aus der Ferne eine Leiter. Ich hasse Leitern, im Flachland wie in den Bergen. Und das ist der Moment, in dem Vernunft, vielleicht auch Angst, über Mut und Unerschrockenheit siegen. Denn ich weiß nicht, wie es auf der anderen Seite weitergeht. Eine 10 Meter hohe Leiter mit einem weit über 15 Kilo schweren Rucksack hinauf – und dann? Verdammter Mist. Vor zehn Minuten bin ich an der Stelle vorbeigekommen, an der der Weg hinunter nach Holzgau ins Lechtal abzweigt. Ich beschließe also, umzukehren und diesen Weg zu nehmen. Schon nach wenigen Minuten kommen wir einige andere Bergsteiger mit hübsch leichten Rucksäcken entgegen. In einem kurzen Gespräch erklärt einer, dass es nach der Leiter eigentlich kaum schlimmer sei als jetzt. Klar, nun schwanke ich in meiner Entscheidung, beschließe aber mannhaft, dass man sich nicht innerhalb einer Viertelstunde dauernd umentscheiden kann. Tja, so viel Konsequenz muss natürlich – bestraft – werden. Schon beim Einstieg in den Abstieg muss ich feststellen: Hier ist seit Beginn der Kälteperiode niemand mehr gegangen. Von einem Weg durch dieses Labyrinth aus dicken Felsblocken ist unter dem Schnee absolut nichts zu sehen, meine Erfahrung führt immerhin dazu, dass ich immer mal wieder eine Markierung sehe, weil ich instinktiv den Gedanken der Wegebauer folge. Mein Schutzengel hat allerdings in den nächsten eineinhalb Stunden wirklich einen harten Nachmittag, denn dass ich in dem Gelände heil nach unten komme, dass ist nicht allein meiner athletischen Erscheinung zu verdanken. Ein bisschen Glück ist auch dabei und die blauen Flecken von den paar Stürzen geben mir noch viele Tage später Anlass zu Sorgenfalten. Irgendwo da bin ich runtergekommen! Meine Laune gerät allerdings nicht ins Wanken und das ist schön zu sehen. Es gibt schon das eine oder andere unschöne Wort, was ES zu mir spricht, aber Schwamm drüber. Ansonsten sage ich mir: Achim, was soll das Jammern, du schaffst es ja trotzdem. Als ich dann aber endlich wieder festen Boden unter den Füßen habe, macht sich ein Gefühl der Erleichterung breit. Es ist zwar noch ein langer Weg ins Tal, die Alpe, auf die ich mich gefreut habe, hat schon zu, der Weg wird länger und länger, es fängt heftig zu regnen an – zu wissen, man schafft es trotz aller Widrigkeiten, das verleiht Kraft. Kurz vor Holzgau habe ich endlich wieder ein Netz, doch leider sind meine Versuche, die Falchs telefonisch zu erreichen, erfolglos, also muss ich anders unterkommen.
[photoshelter-img i_id=“I0000MkmZf.wLaVE“ buy=“0″ width=“200″ height=“321″]
Vor dem erstbesten Gasthof lasse ich mich unter einem Vordach nieder – nach einiger Zeit kommt die Bedienung heraus und will mir die Karte bringen. Ich kläre sie darüber auf, dass ich bei diesem Sauwetter nicht im Freien zu essen gedenke und viel lieber wissen möchte, ob sie ein Einzelzimmer frei hätten und was es kosten würde. Sie entschwindet und nach fünf Minuten erscheint der Chef des Hauses. „Sie suchen ein Einzelzimmer?“ – „Ja!“ – „Haben wir!“ – „Schön, was kostet es?“ – „44 Euro zuzüglich 11 Euro Einzelzimmerzuschlag!“ – „Wenn Sie Einzelzimmer anbieten, wieso kosten die dann extra?“

Darauf gab er keine Antwort und ich erklärte ihm, dass ich dann halt noch ein wenig weiterwandern würde. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass das Etablissement mit Services für Wanderer wirbt, die den Fernwanderweg E5 gehen.\r\n\r\nKurze Zeit später in einem anderen Hotel in Holzgau, in dem ich ohne viel Hoffnung und mit schlechtem Gewissen triefend und verdreckt in den Gastraum eintrete: Um die Ecke kommt eine fesche Bedienung in einem reizenden Dirndl, die mich anstrahlt und meint: „Du siehst aus, als könntest du ein Zimmer brauchen!“ Ich frage, ob es so schlimm sei und sie nickt feierlich. Auf die Frage nach dem Preis nennt sie einen, bei dem ich nicht nein sagen kann. „Dafür“, erklärt dieser Engel im Dirndl, „gibts aber auch eine heiße Dusche und ein kräftiges Frühstück dazu.“ Nach einem guten Frühstück im Holzgauer Hof. Der Rucksack sitzt noch etwas schief, aber die Stimmung ist schon wieder bestens. Danke an Sigrid und ihr Team.\r\n\r\n \r\n\r\nNachdem ich wieder halbwegs passabel aussehe, gönne ich mir ein schönes Abendessen und lerne Sigrid, die Chefin, kennen. Die Fürsorge hier ist einfach Klasse, es gibt riesige Unterschiede im Gastgewerbe. Als ich schließlich frage, ob ich meine Sachen irgendwo trocknen könnte, weist sie mich an, sie einfach in den Flur zu legen, sie würde sich darum kümmern. Das ist mir unangenehm, denn meine Klamotten und Schuhe sehen furchtbar aus, aber Widerspruch ist zwecklos. Nicht nötig zu erwähnen, das am nächsten Tag alles wieder schön trocken ist. Darum an dieser Stelle der ausdrückliche Hinweis: Wanderer, kommst du nach Holzgau, wandere nicht am Holzgauer Hof; vorbei, denn hier kannst du echte Gastfreundschaft genießen. Der Rest ist schnell erzählt. Ich fahre mit dem Bus nach Sonthofen. Das dauert, die Umsteigezeiten sind lang, aber was soll’s! Zeit zum Nachdenken ist Quality time! Das waren gute Tage und wirklich: Ich habe mich verändert. Das Wiedersehen mit Tanja, mit Evi und Nadine und ein schöner Abend in einer Oberstdorfer Kneipe waren ein würdiger Abschluss. Ich habe mein Leben neu gewonnen.